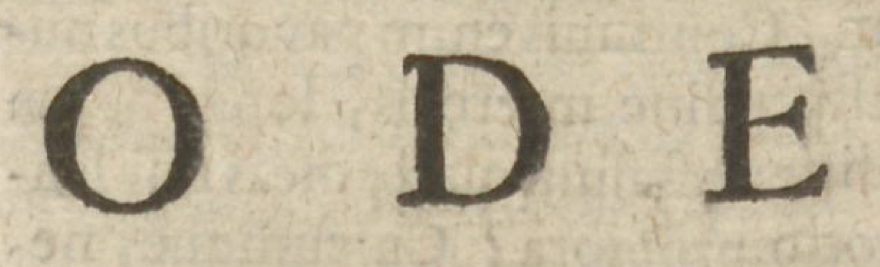
Martin Opitz zählt am Ende des V. Capitels seines Buchs von der Deutschen Poeterey die Ode zu den „Lyrica“, also zu den „getichte[n] die man zur Music sonderlich gebrauchen kan“ – und er macht eine zusätzliche Bestimmung: Sie „erfodern zueföderst ein freyes lustiges gemüte“. Der Beispieltext, mit dem er das Kapitel abschließt, ist dementsprechend ein strophisches Lied, das dazu einlädt, den Blick nicht nur in die Bücher zu versenken, sondern auch „hienauß zue schauen“ und „sich bey den frischen quellen / Jn dem grünen zue ergehn“.
Die Ode ist aber durchaus mehr als einfach ein strophisches Lied. Schon von ihrem Ursprung her, in der griechischen Antike, konnte sie alternativ auch eine metrisch und strophisch höchst komplex gebaute lyrische Gattung mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen sein, etwa bei Simonides von Keos und Pindar. Gerade die pindarische Odenform spielt in der Formensprache des deutschen Barock eine bedeutende Rolle: Die Odenbücher des Andreas Gryphius etwa enthalten pindarische Oden ebenso wie strophische Lieder à la Opitz (allerdings zumeist ohne „freyes lustiges gemüte“).
Welche Gattungsbestimmungen die Ode im 17. und im 18. Jahrhundert erfuhr, in welchen Formen sie sich ausprägte – v.a. in den kunstvollen Oden Klopstocks –, soll im Seminar an vielfältigen Beispielen erarbeitet werden. Dabei wird die metrische Analyse ebenso wie die ideen- oder sozialgeschichtliche Kontextualisierung und Deutung im Zentrum stehen.
- Kursleiter/in: Benedikt Jessing
- Kursleiter/in: Nicola Kaminski
